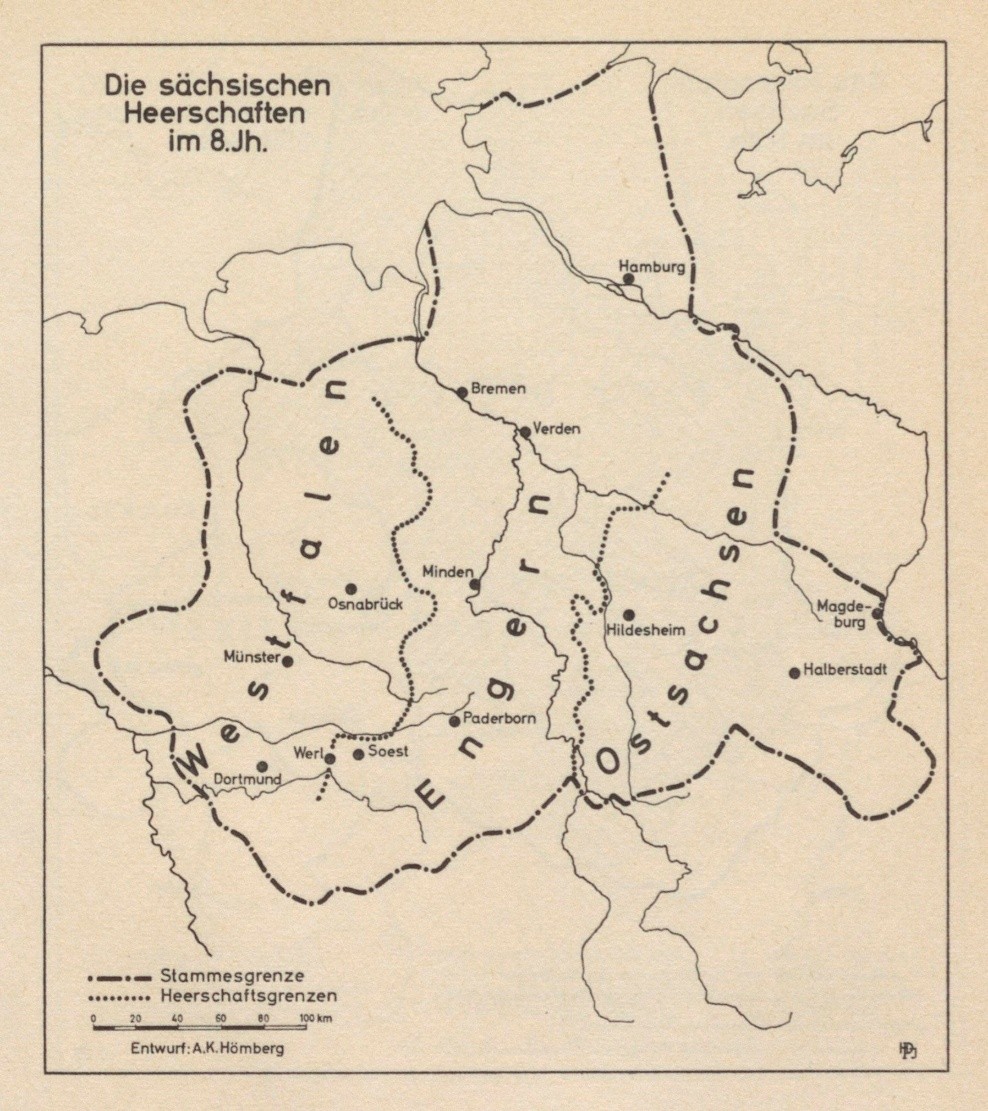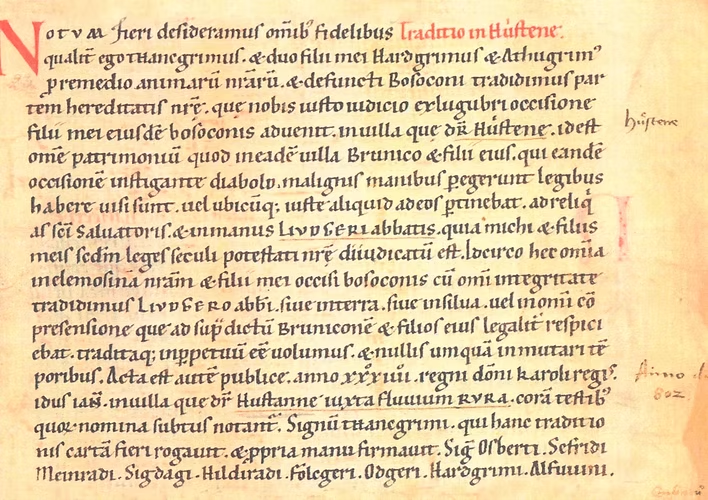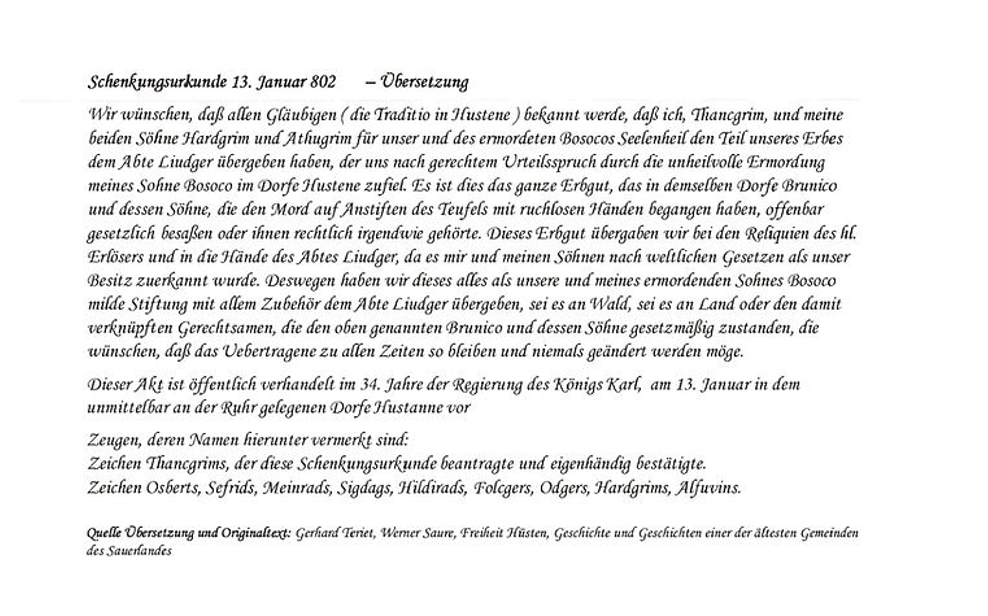Durch die Industrialisierung ist der Einsatz für die Arbeiter immer wichtiger. 1911 gründet sich die Katholische Arbeiter Bewegung (KAB).
Im 1. Weltkrieg wird die Tragik des Krieges am Infanterie-Regiment 81 deutlich. Aus dem „Sauerländer Regiment“ lassen am 22.08.1914 in der Schlacht bei Neufchâteau u.a. 18 Soldaten aus Hüsten ihr Leben.
Ab 1933 bestimmt in Hüsten die NSDAP die Entwicklung. Neben Fackelzügen, der Diskreditierung von Politkern (z.B. Dr. Rudolf Gunst) und der Verfolgung jüdischer Hüstener war auch die Pfarrei betroffen.
Ein Beispiel ist die Zerschlagung der katholischen Jugendbewegung „bündische Jugend“ (1936) durch die Hitler-Jugend (HJ) oder der Versuch des HJ-Führers den Pfarrer Theodor Meckel zu sich zu zitieren. Den Termin nahm Vikar Peter Schumacher wahr. Der HJ-Führer warnte den Vikar vor „verleumderischen Aussagen“ und drohte mit Gefängnis. Daraufhin gab ihm Vikar Peter Schumacher eine schallende Ohrfeige. Er fügte hinzu, diese habe er aufgrund seiner Unverschämtheit von einem deutschen Marineoffizier erhalten. Peter Schumacher übernahm 1934 die Pfarrei Hl. Geist Unterhüsten.
Am 13. April 1945 marschierten amerikanische Truppen ein. Der Wandel begann. Es gab einen Arbeitskreis des geistlichen Studienrates Heinrich Thöne. Daraus ergab sich der Wille zur Gründung einer Christlich Demokratischen Partei in Hüsten (09.08.1945).
Die Besinnung auf christliche Werte äußerte sich auch im christlichen Leben:
1950: Gründung des Katholischen Kaufmännischen Vereins (KKV)
1952: Gründung der Pfadfinder
1957: Gründung der Kolpingfamilie aus dem Gesellenverein (1855)
1977: Gründung des Missionskreises
1978: Gründung des Kreises alleinstehender Frauen
1983: Gründung des Orgelbauvereins
1986: Organisation des Krankenhausbesuchsdienstes der Caritas
Neben diesen Gründungen gab es neue pastorale Impulse:
1975: Erste Blickpunkt-Ausgabe erscheint
1977: Erstes Kommunionkinder-Zeltlager (Kokilager) in Pastors Garten
1981: Erste Agape-Feier mit Brot und Wein nach der Osternacht
1985: Erstmalig ist eine Gruppe Olper Pilger auf ihrer Wallfahrt nach Werl Gast in Hüsten
1986: Das neu erbaute Petrushaus wird eingeweiht
1993: Der Kirchplatz inklusive Marktbrunnen wird neugestaltet
1997: Erstmals verrichten Messdienerinnen ihren Dienst
2002: Der erste Kinderbibeltag wird durchgeführt
Großen Anteil daran hat Pfarrer Henkemeier. Er war von 1974 bis 2003 oberster Hirte in Hüsten.
Anfang der 00er Jahre wurde deutlich, dass die Mitgliederzahlen sinken und es neuer Strukturen bedarf. 2001 wurde der Pastoralverbund Röhr-Ruhr gegründet.
2013 Gründung der Gesamtpfarrei St. Petri Hüsten durch Pfarrer Dietmar Röttger (2003 – 2016). Bestandteil ist der Pastoralverbund Röhr-Ruhr und der Pastoralverbund Kloster Oelinghausen.
Seitdem befindet sich die Pfarrei mit Dechant Daniel Meiworm auf dem Weg des gemeinsamen Schaffens.
Teil des Schaffens ist der Schwerpunkte Kirchmusik, das sozial pastorale Zentrum mit den Begegnungscafés und das aktive Leben in den Gemeinden.